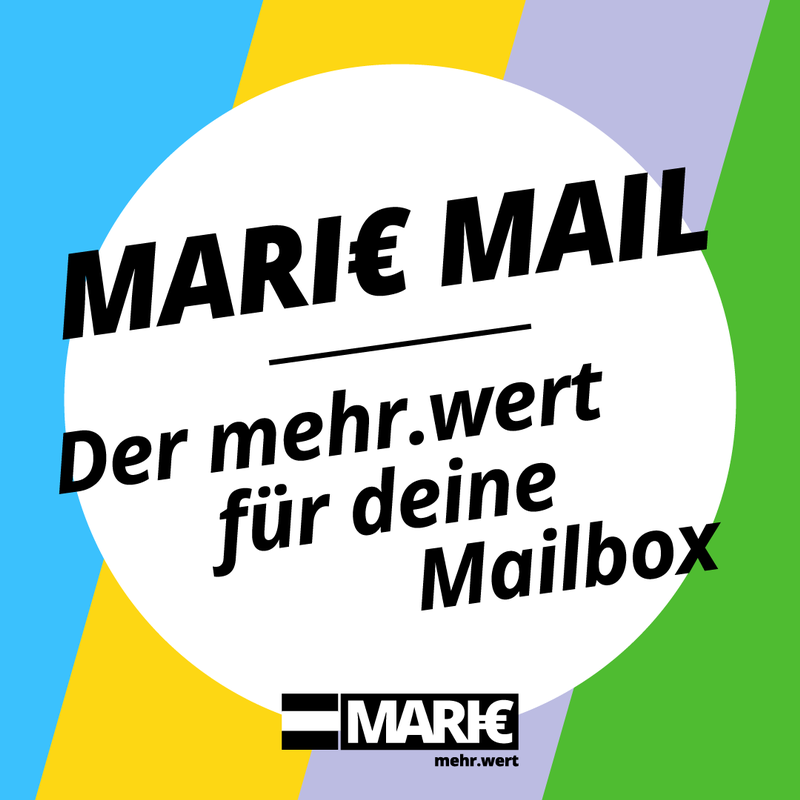Stephan Schwarzer, Ex-Abteilungsleiter für Umwelt- und Energiepolitik in der WKÖ und aktuell Geschäftsführer der eFuel Alliance Österreich, analysiert die Schwachstellen des European Green Deal.
Ich war nie ein Klimaskeptiker. Klimaschutz ist eine enorm wichtige Aufgabe. Ich möchte, dass es unsere Kinder und Enkelkinder gut haben. Klimaschutz muss aber rational angegangen werden. Ich beobachte Alarmismus, Populismus, Dilettantismus. Den Großmächten, die die EU schwächen wollen, spielen naive, unbeholfene Versuche der Rettung des Weltklimas in die Hände, weil die EU dafür einen hohen Preis zahlt.
Bei seiner Verkündung Mitte 2019 hat der European Green Deal (EGD) in mir große Hoffnungen erweckt. "Endlich ein großer Wurf", dachte ich unwillkürlich. "Wachstum durch Klimaschutz", hieß die offizielle Parole. Gute Arbeit – leider in erster Linie von der Marketing-Abteilung. Auf inhaltlicher Ebene waren sogleich fundamentale Fehler und Lücken sichtbar. Ich muss mir nicht nachsagen lassen "hinterher ist jeder klüger", denn ich habe meine Bedenken sehr rasch in den Diskurs eingebracht.
Spannende Updates für dich!
Mit der MARI€ MAIL erhältst du unsere wichtigsten Infos direkt in deine Mailbox.
Jetzt zum Newsletter anmelden!
Im Sommer 2020 habe ich in der Ausgabe 2/2020 von ÖKO+ geschrieben: "Was wir vermeiden wollen, ist das Abdrängen energieintensiver Produktionen aus Europa, das ist genau der verkehrte Weg. Aus Klimasicht und neuerdings, aus Sicht der Resilienz will die Politik Wertschöpfungsketten nach Europa zurückholen. Dennoch sehen wir weiter die Gefahr des Abwanderns, der ‚Green Deal‘ lässt hier die notwendige Klarheit vermissen. Die Verschärfung der bereits strengen Unionsziele wirkt auf die energieintensive Industrie bedrohlich." Das Fehlen tragender Säulen habe ich zu Beginn 2020 in Rauner/Robinson (Hg), Ökosoziale Zukunftspartnerschaft, aufgezeigt.
Gravierende Defizite wurden selbst dann nicht korrigiert, als die negativen Ergebnisse schon unübersehbar wurden. Für Rückschläge wurde stets der militärische Konflikt zwischen Russland und der Ukraine verantwortlich gemacht. Spät, aber doch soll der überbordende EGD nun durch den Clean Industrial Deal (Link) ersetzt werden. Paradoxerweise hat die scheidende Kommission von der Entwicklung unbeeindruckt noch belastende Rechtsakte in die Scheune gebracht, als die designierte Kommission schon den Rückbau der Rechtsmasse propagierte.
Die Defizite des EGD betreffen nicht Kleinigkeiten, sondern den nervus rerum:
Manko #1: Fehlender internationaler Anspruch
Der EGD ließ den internationalen Anspruch vermissen. Dieser Kardinalfehler macht bereits alles zunichte. Ein auf die eigenen Emissionen reduzierter EGD ist kein ernsthaftes Klimaschutzprogramm. Er beschäftigt sich mit 7% der Weltemissionen, als wären sie 100%, und vernachlässigt die restlichen 93%. Man hätte nur die eigene Parole "Wachstum durch Klimaschutz" ernst nehmen müssen. Wie können Entwicklungs- und Schwellenländer schneller nachhaltige Technologien nutzen, und was kann die EU dazu beitragen? Wirtschaftliche Entwicklung ist die beste Triebfeder des Klimaschutzes. Arme Länder werden zu Energieexporteuren für reiche Länder, die Investitionen unterstützen. Wo war die Klimaaußenpolitik der von Energieimporten schwer abhängigen EU, die wirtschaftliche Interessen in Energiepartnerschaften zusammenführt? Ich habe sie nicht gesehen. Die EU-Regulative errichteten stattdessen unter dem Vorzeichen der Nachhaltigkeit Importhürden.
GRAFIK: Fossile CO₂-Emissionen nach Ländern
Manko #2: Rechtslastigkeit
Alles, was man sich wünschen kann, wurde in unzähligen Rechtsakten von A-Z durchnormiert. Regulatorik wurde vom Segen zum Fluch. Ein Dutzend Bürokratiemonster lähmt neben großen Unternehmen auch die KMU. Die Branche, die derzeit am meisten wächst, ist die Zertifizierungsindustrie, und die regulierten Unternehmen müssen Legionen von Compliance-Officern einstellen, man sieht es bei den Stellenausschreibungen.
Manko #3: Ausschluss relevanter Optionen
Man kann das Emittieren von CO₂ noch so teuer machen, es wird an den Emissionen nichts ändern, wenn keine Alternativen zur Verfügung stehen. Wasserstoffrhetorik reicht nicht, es braucht Wasserstoff, und das in ausreichenden Mengen zu kalkulierbaren, wettbewerbsfähigen Preisen.
Grünes Methan als Ersatz für Erdgas? Fehlanzeige. Green Liquids als Ersatz für erdölbasierte Produkte bei Millionen Kraftfahrzeugen: unerwünscht. Und wenn die alternativen Energieträger nicht bereitstehen, hätte die EU zumindest die CO2 -Abscheidung ermöglichen können. Das alles hat sie verabsäumt.
Hohe Preise und die Erwartung, dass sie weiter steigen, erzeugen Abwanderungsdruck. Die De-Industrialisierung Europas ist hausgemacht und nicht nur durch den militärischen Konflikt bedingt. Und man muss es in aller Deutlichkeit sagen: Die De-Industriealisierung steht erst am Anfang.
Manko #4: Fehlende Interessenabwägung
Die Devise "koste es, was es wolle" prägte auch den EGD. Vorhalte der Industrie gegenüber den EGD-Machern, dass Arbeitsplätze verloren gingen, wenn man die regulatorischen Schrauben derart anziehen würde, wurden gar nicht bestritten. O-Ton: "Dann sind diese Industrien halt weg, die Leute werden wir entschädigen". Die EU hat den Verbrennerautos den Kampf angesagt, bei denen sie Weltmarktführer war. "Der Klimaschutz erfordert es, dass wir Opfer bringen", konnte man hören. Damit hat man in einer Leitindustrie zehntausende Arbeitsplätze zerstört, es hätte – bessere – Alternativen gegeben. Der EGD hat das Kind mit dem Bad ausgeschüttet.
LITERATURTIPP: ÖKO+
Diese Analyse von Stephan Schwarzer ist erstmalig im März 2025 im Fachmagazin für Ökonomie + Ökonomie ÖKO+ erschienen. In spannende Storys verpackt und durch übersichtliche Grafiken optisch ansprechend aufbereitet, beleuchten Expert:innen der WKÖ Abteilung für Umwelt- und Energiepolitik darin die neuesten Entwicklungen im Bereich Ökologie. Ebenso kommen externe Fachexpert:innen sowie Vertreter:innen von Unternehmen zu Wort.
Neugierig geworden? Hier kannst du dir die gesamte Ausgabe kostenlos herunterladen und dich für den Newsletter zu ÖKO+ anmelden.
EU hat sich überschätzt
Unterm Strich steht: Die EU hat sich übernommen, sie hat Augenmaß vermissen lassen. Das Festlegen von quantitativen Zielen reicht nicht, man muss sich die Emissionsreduktionen durch Maßnahmen erarbeiten. Und ohne globales Denken macht es keinen Sinn: Technologien müssen ausgerollt werden, die am gesamten Globus wirksam werden können. Was der EGD bewirkt, ist die Verlagerung von Emissionen aus der EU hinaus, außerhalb der EU fallen sie in doppelter Menge an. Das ist schlechter als ein Nullsummenspiel. Wenn die Kommission meinte, dass die anderen Länder dem "Erfolgsmodell" der EU schon folgen würden, so stellen wir heute genau das Gegenteil fest.
Was muss besser werden?
Die EGD-Mankos kann die EU abstellen, sie muss es nur tun: Rückbau der Überregulierung, Aufbau von Energiepartnerschaften mit Ländern außerhalb der EU, Anschub von Game-Changer-Technologien wie Grüngas, Green Liquids, CO₂ -Management. Das System Eisenbahn und die Güterbeförderung über die Wasserstraße müssen von der EU und den Mitgliedstaaten aus dem Dornröschenschlaf geweckt werden. Es wäre höchste Zeit damit zu beginnen, es ist schon viel Zeit verloren gegangen.
Mehr Ehrlichkeit wäre anzuraten. Der Bevölkerung weiszumachen, dass es keine Katastrophen mehr geben wird, wenn der EGD weitergeführt wird, ist Populismus, das Schüren von Ängsten für politische Zwecke.
Die Erderwärmung ist Realität. Globale Emissionsminderungen wirken sich mit erheblicher Zeitverzögerung aus, das Verschieben der Emissionen von der EU anderswohin natürlich gar nicht. An erster Stelle muss stehen, die Menschheit vor den negativen Folgen des Klimawandels zu schützen.
Europäische Kommission bereit für Kurswechsel
Mittlerweile sind die Defizite des EGD offiziell anerkannt, die EK gelobt Besserung. Die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Denn die Bürokratie wuchert in Form durchführender Rechtsakte noch weiter. Ein schlimmes Beispiel ist die Wasserstoffpolitik, die eines der Herzstücke sein müsste. In fünf Jahren hat man keine brauchbare Definition gefunden, die beschlossenen Konvolute ermöglichen nicht, sie verhindern. Hier nützt nicht einmal die Beseitigung, es braucht eine neue straffe Regelung, aber nicht in weiteren fünf Jahren, sondern gleich.
Das Lichten des Dickichts gereicht dem Klimaschutz zum Vorteil. Klimaschutz ist erfolgreich, wenn er "aus der Mitte für die Mitte" gemacht wird. Momentan hat man den Eindruck, er komme "aus der Blase für die Blase." Bei Wahlen findet diese Politik wenig Anklang, obwohl die Bevölkerung Klimaschutz als sehr relevantes Thema betrachtet.
Beim Klimaschutz gibt es somit viel Luft nach oben. Im Übereifer und wegen des Ausblendens von Schlüsseltechnologien hat der EGD die EU geschwächt und seine eigenen Klimaschutzziele verfehlt. Ein starkes Europa kann globales Zugpferd des Klimaschutzes sein, ein schwaches wohl kaum.
Das Wichtigste in Kürze:
Stephan Schwarzer analysiert die Schwachstellen des European Green Deal der Europäischen Kommission. Seine 5 Hauptkritikpunkte sind:
- Fokus zu eng: EGD behandelt nur 7 % der globalen Emissionen, internationale Kooperation fehlt.
- Überregulierung: Zu viele komplizierte Vorschriften, besonders für KMU belastend.
- Technologieauswahl zu eng: Potenziale wie eFuels oder CO₂-Abscheidung wurden ignoriert.
- Wirtschaft vernachlässigt: Maßnahmen ohne Rücksicht auf Jobs und Industrie – De-Industrialisierung droht.
- Vertrauen fehlt: EU-Kommission will Kurs korrigieren, doch Umsetzungszweifel bleiben.