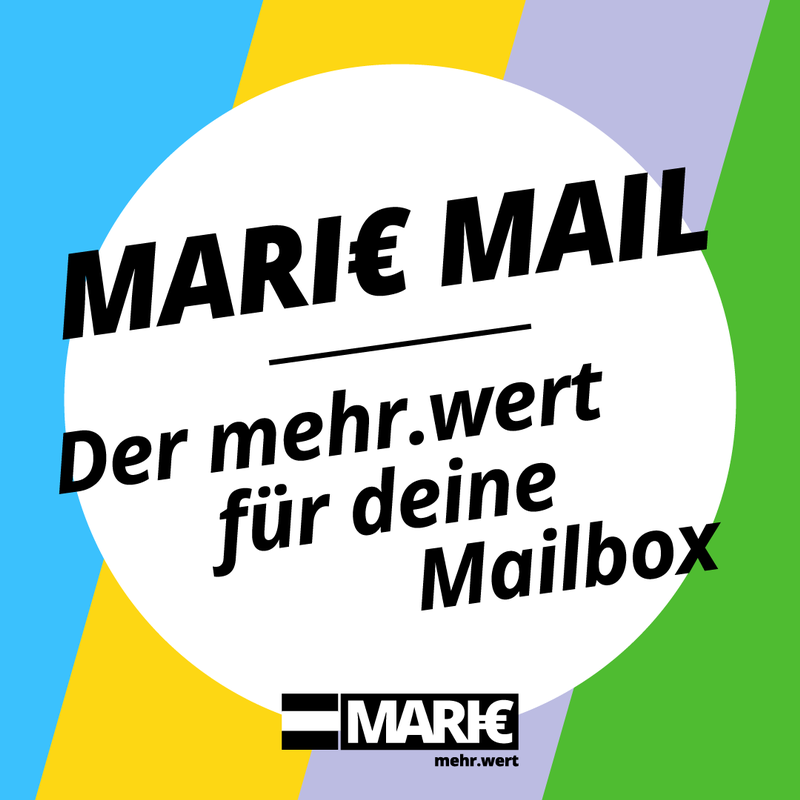Bis Juni 2026 ist die EU-Lohntransparenz-Richtlinie umzusetzen, die umfangreiche Pflichten für Unternehmen bringt. Was sind die Hintergründe, was werden die Auswirkungen auf Einkommen sein?
Man muss nicht alle 24 Seiten (!) der Richtlinie 2023/970 des Europäischen Rates – besser bekannt als EU-Lohntransparenz-Richtlinie – lesen, um zu erkennen, dass sie Unternehmen sehr viel Bürokratie bringen und tief in Lohnstrukturen eingreifen wird. Doch wie so oft steht hinter Bürokratie ein legitimes Interesse – in dem Fall das Interesse, den Einkommensunterschied zwischen den Geschlechtern zu reduzieren.
Kaum ein Wert betrifft den Menschen stärker als das monatliche Einkommen. Es ist Gradmesser für den Wohlstand des Einzelnen und der Volkswirtschaft (BIP/Einwohner = Prokopfeinkommen), für den Stellenwert des Einzelnen und von Gruppen sowie für (Un)Gleichheit und Leistungsgerechtigkeit in einer Gesellschaft.
Hintergrund: Was bringt die Entgelttransparenz-Richtlinie?
Die EU-Lohntransparenz-Richtlinie bringt weitreichende Pflichten für Unternehmen und kann Lohnstrukturen durcheinanderbringen.
Gender Pay Gap vergleicht Äpfel mit Birnen
Im politischen Fokus steht dabei vor allem der Einkommensunterschied zwischen den Geschlechtern, alle paar Monate zelebriert durch die "Equal Pay Days" und am Frauentag. Dabei reduziert sich der Fokus stets auf eine Zahl – den Prozentsatz, um den der Stundenlohn von Frauen im Schnitt unter jenem der Männer liegt. Dabei lag Österreich mit 18,3% laut Statistik Austria im EU-Vergleich 2024 hoch, also schlecht. Bereinigt man den Wert um objektive Faktoren wie Alter, Ausbildung, Berufserfahrung und Branche, sinkt er auf 6,3% laut Stepstone Gehaltsreport 2025, ein international niedriger Wert.
Weil politisch opportun, wird immer nur der unbereinigte Wert thematisiert, der aber Äpfel mit Birnen vergleicht: Eine hohe Frauenerwerbsquote erhöht z.B. den Gap: Italien und Rumänien verzeichnen einen geringen Unterschied, weil hier nur wenige, vor allem qualifizierte Frauen überhaupt erwerbstätig ist. Hingegen erhöht sich die Kluft in Österreich dadurch, dass Männer 70% der (zuschlagspflichtigen) Überstunden leisten und den Großteil der Zulagen für Schmutz, Erschwernis und Gefahren kassieren. Ungerecht? Nein, denn auch drei Viertel der Arbeitsunfälle erleiden Männer.
Letztlich war dieser EU-weit feststellbare (undifferenzierte) Gender Pay Gap Auslöser der Lohntransparenz-Richtlinie. Die Erwägungsgründe 2 und 3 führen die Gleichstellung von Frau und Mann sowie die Bekämpfung der Diskriminierung aus Gründen des Geschlechts an. Erwägungsgrund 4 spricht – schon wesentlich präziser – vom "Grundsatz gleiches Entgelt bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit". Dem kann sich nun niemand verschließen. Es ist auch im Interesse von Unternehmen, die im Wettbewerb stehen, leistungsgerecht zu entlohnen, also Gleiches gleich und Ungleiches ungleich.
Was ist gleichwertige Arbeit?
Klingt einfach, ist aber vielschichtig. Das beginnt schon mit der Frage, was gleichwertige Arbeit ist. Zumindest diese erste Aufgabe der Richtlinie, nämlich Gruppen mit gleichwertiger Arbeit zu bilden, wird den Unternehmen in Österreich abgenommen. Jede Branche hat ihren Kollektivvertrag mit Beschäftigungsgruppen. Diese fassen meist unterschiedliche Berufe mit demselben Niveau an Qualifikation, Verantwortung, etc. zusammen. Aber was, wenn der Arbeitgeber der IT-Kraft (meist ein Mann) aufgrund des Marktwerts mehr zahlen muss als der Assistenz? Dann entsteht in einer Gruppe ein (unerwünschter) Gap, den der Arbeitgeber laut Richtlinie rechtfertigen muss, gemäß EuGH-Judikatur aber auch rechtfertigen kann.
GRAFIK: Durchschnittliche Brutto-Gehälter in Österreich
Aber das Unternehmen muss den Unterschied rechtfertigen und, wenn das nicht gelingt, Maßnahmen ergreifen, um den Gap zu reduzieren. Denn die Stoßrichtung der Richtlinie ist Gleichheit: Man muss jeden Unterschied rechtfertigen, aber nicht, wenn man Tüchtigen und Untüchtigen gleich viel zahlt (obwohl letzteres auch gegen den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz verstößt).
Einkommenstransparenz reduziert den Gap - und die Löhne
Die Richtlinie gibt allen Arbeitnehmern u.a. das Recht, den Durchschnitt der Vergleichsgruppe zu erfahren. Das dürfte den Druck zur Rechtfertigung erhöhen. Denn bekanntlich halten sich je nach Umfrage 70 bis 90% der Menschen für überdurchschnittlich tüchtig, aber es können nicht 70 bis 90% über dem Durchschnitt entlohnt werden. Noch unangenehmer ist es, den Underperformern zu erklären, warum sie unter dem Schnitt liegen. Im besten Fall objektiviert Transparenz die Lohnfindung und verringert ungerechtfertigte Unterschiede, was Produktivität und Zufriedenheit erhöhen kann. Im schlechtesten Fall entsteht Frust.
Spannende Updates für dich
Mit der MARI€ MAIL erhältst du unsere wichtigsten Infos direkt in deine Mailbox.
Jetzt zum Newsletter anmelden!
Die bisherigen Erfahrungen sind ambivalent: Studien zufolge verringern Gesetze zur Einkommenstransparenz tatsächlich den Gender Pay Gap, was positiv ist. Aber sie führen nicht zu einer Nivellierung der Einkommen nach oben – entgegen dem Konzept des Gleichbehandlungsgesetzes -, sondern nach unten. Es ist für Unternehmen einfach schwieriger und längerfristig teurer, Leistungsträgern mehr zu zahlen, wenn die anderen Kollegen dann dasselbe fordern. Das dürfte zu einer Nivellierung zulasten der Leistungsträger – Männer wie Frauen – führen.
Das Fazit: Gut gemeint ist das Gegenteil von gut. Denn zunächst bringt die Richtlinie den Unternehmen mehr Bürokratie, obwohl sie weniger brauchen. Hingegen dürfte der Gleichheitseffekt in Österreich überschaubar sein, beruht doch der Gap großteils auf Faktoren, die nicht in der Sphäre der Richtlinie oder des einzelnen Unternehmens liegen: Branchen- und Berufswahl, Erwerbsunterbrechungen, Freizeitpräferenzen, mangelhafte Kinderbetreuung und viele mehr. Hier ist anzusetzen, aber das ist eine andere Geschichte.