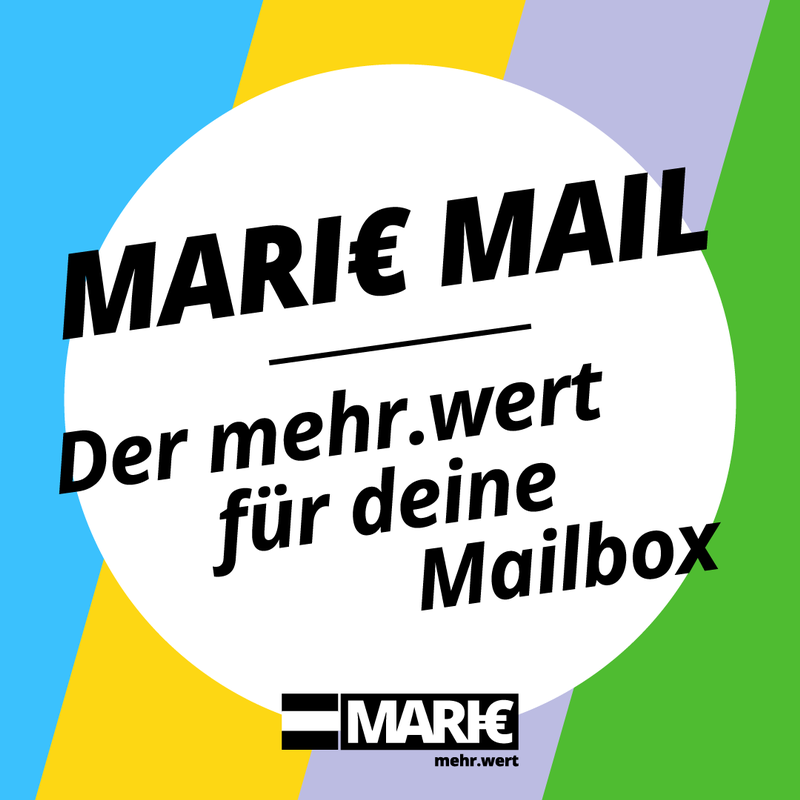Arbeitsforscher Hans Rusinek und Nachhaltigkeitsexperte Harald Zeiss erklären, warum Fachkräftemangel und Sinnorientierung zusammen gedacht werden müssen – und wie Qualitätstourismus und nachhaltige Arbeitsmodelle Österreich eine Pionier-Rolle einnehmen lassen können.
Fachkräftemangel? Dieser bremst ganz klar Österreichs Aufschwung – hiermit haben wir uns bereits an anderer Stelle näher beschäftigt. Vor allem der Tourismus ist Leidtragender, hier verzeichnen 88,8% der Betriebe Personalengpässe. Genau an diesem Punkt setzten die beiden Experten Hans Rusinek und Harald Zeiss bei der WKÖ-Tourismuskonferenz "Tourismus.Zukunft.Österreich. 2025 – Wandel, Werte, Wachstum" in Alpbach an. Wir haben sie zum Gespräch getroffen, um die Frage zu stellen: "Wie müssen wir Tourismus zukunftsfähig aufstellen, damit wir auch pro futuro die Erfolgsgeschichte des österreichischen Tourismus fortschreiben können?"
Resonanz statt Vakuum
Für Arbeitsforscher Hans Rusinek steht ganz klar der Begriff der Sinnorientierung im Mittelpunkt: "Menschen wollen nicht nur beschäftigt, sondern gebraucht werden. Wenn das nicht passt, fehlt der Nachwuchs in der Branche." Gerade im Tourismus müsse Arbeit wieder als Teil einer kulturellen Vermittlungsarbeit verstanden werden – nicht als reine Dienstleistung. "Organisationen können dem begegnen, indem sie Mitarbeiter stärker in Gestaltungsprozesse einbeziehen und Arbeit mit einer erlebbaren Sinnperspektive aufladen."
Spannende Updates für dich
Mit der MARI€ MAIL erhältst du unsere wichtigsten Infos direkt in deine Mailbox.
Jetzt zum Newsletter anmelden!Wie Bindung gelingt
Junge Generationen würden nicht bloß Sicherheit suchen, so Rusinek weiter, sondern Entwicklung und Authentizität. Unternehmen müssen deshalb von der reinen Hierarchiestruktur hin zu Lern- und Beteiligungsarchitekturen wechseln – gerade im Tourismus, wo kreative Konzepte und neue Gästeerlebnisse entstehen. "Wer Talente nicht nur einbindet, sondern ihnen auch Freiräume gibt, schafft Bindung über den bloßen Vertrag hinaus. Retention ist kein Benefit-Programm, sondern eine Lernarchitektur."
Österreich als Laboratorium für neue Arbeitsmodelle
Besonders eindrücklich ist Rusineks Perspektive auf Demotivation: "Empirisch zeigen sich immer wieder drei Faktoren: mangelnde Autonomie, fehlende Wertschätzung und unklare Sinnbezüge, d.h. Fake Work, die keine Probleme löst." Für den heimischen Tourismus sieht er eine besondere Chance: "Österreich verfügt über ein dichtes Geflecht aus Tourismus, Kultur und Natur – ein Laboratorium für sinnorientierte Arbeitsmodelle. Weil hier die gesellschaftliche Erwartung an Gastfreundschaft mit hoher Professionalisierung zusammentrifft, können neue Formen von Arbeitsgestaltung direkt im Alltag erprobt werden."
Nachhaltiger Tourismus bedeutet immer das Zusammenspiel von Ökonomie, Ökologie und sozialer Verantwortung. Österreich ist hier in vielen Bereichen bereits stark aufgestellt.
Für Harald Zeiss, Tourismusforscher und Nachhaltigkeitsexperte, wiederum, lautet die Devise: Qualität statt Quantität im Tourismus. "Die Zukunft des Tourismus liegt tatsächlich nicht im Mehr, sondern im Besser", so Zeiss. "Für Österreich bedeutet das konkret, die Qualität von Erlebnis und Aufenthalt für Gäste zu steigern und gleichzeitig die Lebensqualität der Einheimischen zu sichern." Mobilität, Wohnraum und Arbeitsplätze im Tourismus müssten so gestaltet sein, dass sie allen zugutekommen.
VIDEO: Österreichs Tourismus: KI, Klimawandel und Ganzjahresboom
Nachhaltigkeit als Balanceakt
Dabei fällt auch immer wieder der Begriff der Nachhaltigkeit. "Nachhaltiger Tourismus bedeutet immer das Zusammenspiel von Ökonomie, Ökologie und sozialer Verantwortung. Österreich ist hier in vielen Bereichen bereits stark aufgestellt. Besonders gelungen ist die Verbindung von Regionalität, Kulinarik und Kultur, die Gäste und Einheimische gleichermaßen bereichert", so Zeiss. Gleichzeitig gibt es Baustellen wie die Wohnsituation in touristischen Ballungsräumen, Verkehrsbelastung und der Schutz sensibler Naturräume. "Diese Herausforderungen lassen sich nur durch konsequente Steuerung und klare Prioritätensetzung bewältigen."
Unbalanced Tourism: Zuckerbrot und Peitsche
Beim Thema Unbalanced Tourism legt Zeiss den Finger in strukturelle Wunden: "Wo die Bevölkerung zu Recht über zu viele Touristinnen und Touristen klagt, braucht es klare Instrumente der Besucherlenkung. Zuckerbrot bedeutet, attraktive Alternativen zu schaffen: Angebote in der Nebensaison, Shuttle-Systeme, digitale Services und Anreize, sich räumlich oder zeitlich anders zu bewegen. Peitsche bedeutet, Grenzen zu setzen, wenn es notwendig ist: Parkraumbewirtschaftung, temporäre Zugangsbeschränkungen oder Kontingente an stark frequentierten Orten."
Österreichs Hebel für Qualitätstourismus
Österreich habe zudem die besten Voraussetzungen, um Qualitätstourismus auszubauen: "Die größten Hebel liegen in der grenzüberschreitenden Verbesserung der Mobilität, im gezielten Ausbau hochwertiger und authentischer Angebote und in der Transparenz in der Finanzierung. Wenn die Menschen sehen, dass Einnahmen aus dem Tourismus direkt in ihre Mobilität, ihre Wohnqualität und ihre Erholungsräume zurückfließen, stärkt das die Identifikation mit dem Tourismus und sichert den Standortvorteil langfristig."
Sinn entsteht, wenn Handeln über den Moment hinaus trägt; Nachhaltigkeit ebenso. Wenn Beschäftigte im Tourismus erleben, dass ihr Tun nicht nur Gästen dient, sondern auch Landschaften, Gemeinden und künftigen Generationen, wird Arbeit zur Quelle von Sinn.
Sinn und Nachhaltigkeit: Zwei Seiten derselben Medaille
Beide Experten kommen von unterschiedlichen Seiten – Rusinek aus der Sinnforschung, Zeiss aus der Nachhaltigkeitsforschung. Doch ihre Antworten treffen sich in einem Punkt: Langfristigkeit. Rusinek: "Sinn entsteht, wenn Handeln über den Moment hinaus trägt; Nachhaltigkeit ebenso. Wenn Beschäftigte im Tourismus erleben, dass ihr Tun nicht nur Gästen dient, sondern auch Landschaften, Gemeinden und künftigen Generationen, wird Arbeit zur Quelle von Sinn." Zeiss ergänzt: „Menschen, die im Tourismus arbeiten und diesen Sinn spüren, sehen ihre Tätigkeit nicht nur als Job, sondern als Beitrag zu einer lebenswerten Region. Diese Sinnhaftigkeit führt zu höherer Motivation, stärkerer Bindung und letztlich zu einer neuen Qualität des Arbeitslebens.“
Fazit – Österreich als Zukunftslabor
Die Botschaft beider Experten ist klar: Österreich hat die Chance, Arbeit im Tourismus neu zu denken – sinnorientiert, nachhaltig, zukunftsfähig. Die Schnittmenge aus innerem Sinn und äußerem Standortvorteil kann eine neue Qualität im Arbeitsleben schaffen. Österreich ist damit ein Land voller Potenzial, in dem Zukunft gestaltet werden kann.
Das Wichtigste in Kürze:
- Sinn statt Stress: Arbeit im Tourismus muss wieder Bedeutung haben – das bindet Fachkräfte.
- Junges Arbeiten: Wer Mitgestaltung und Freiraum bietet, gewinnt junge Talente.
- Österreichs Chance: Kultur, Natur und Tourismus machen uns zum Labor für neue Arbeitsmodelle.
- Weniger ist mehr: Qualität statt Masse bringt nachhaltigen Tourismus voran.
- Sinn und Nachhaltigkeit: Gemeinsam gedacht, werden sie zum Standortvorteil.