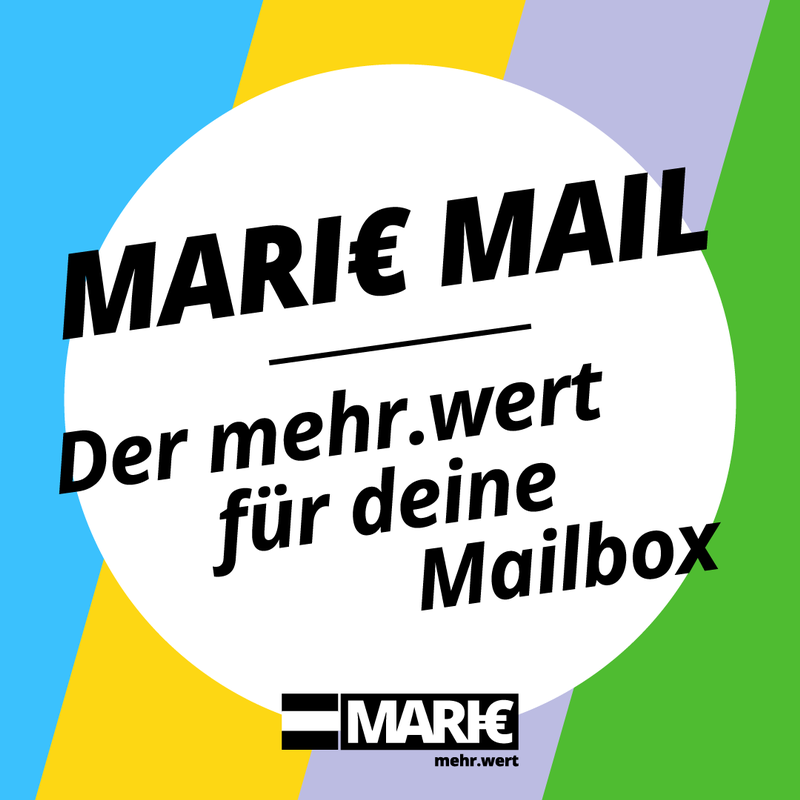Ein starkes KI-Ökosystem treibt Innovation und Wirtschaftswachstum an. Hier liest du, welches Potenzial Österreich hat – und wo es Aufholbedarf gibt.
Digitalisierung und künstliche Intelligenz besitzen ein enormes Potenzial für Wirtschaft und Gesellschaft. Unternehmen, die KI gezielt einsetzen, können ihre Innovationskraft und Effizienz steigern, neue Geschäftsmodelle entwickeln und Wettbewerbsvorteile erzielen. Die großen Player in den USA zeigen es vor. Im Vergleich dazu hinken Europa und auch Österreich hinterher.
Der wirtschaftliche Erfolg mit KI ist kein Selbstläufer. Wie eine Studie der KMU Forschung Austria über KI-Ökosysteme zeigt, sind technologische Spitzenkompetenz, Fachwissen sowie Netzwerke und Partnerschaften ebenso entscheidend wie förderliche wirtschaftliche und regulatorische Rahmenbedingungen, um die mit KI verbundenen Marktpotenziale erfolgreich nutzen zu können. Kurz gesagt: Es geht um ein funktionierendes KI-Ökosystem.
Spannende Updates für dich
Mit der MARI€ MAIL erhältst du unsere wichtigsten Infos direkt in deine Mailbox.
Was ist ein KI-Ökosystem?
Ein KI-Ökosystem umfasst alle relevanten Akteur:innen, ihre Interaktionen und ihr Umfeld, also die strukturellen und institutionellen Rahmenbedingungen. Dazu zählen Unternehmen, Universitäten, Verwaltungseinrichtungen, Netzwerke und Partnerschaften ebenso wie KI-Anwender:innen und die zugrundeliegende Infrastruktur und Fördermechanismen.
Als Good-Practice-Beispiele der KI-Ökosysteme gelten etwa Kanada, Deutschland, die Niederlande und Schweden. Sie verfügen über eine nationale KI-Strategie, eine adäquate Ressourcenausstattung sowie Universitäten, Start-ups und Großunternehmen, die als zentrale Impulsgeber:innen für künstliche Intelligenz fungieren.
5 wichtige Maßnahmen für österreichische Unternehmen
Damit österreichische Unternehmen das volle Potenzial eines KI-Ökosystems ausschöpfen können, braucht es laut der KMU Forschung Austria-Studie folgende 5 Maßnahmen:
Maßnahme #1: Gezielte Investitionen in niederschwellige Unterstützungsmaßnahmen und effektive Wissenstransferformate, um die Nachfrage lokaler Unternehmen (inkl. KMU) nach KI-Anwendungen zu stärken.
Maßnahme #2: Ein institutionalisiertes Ökosystem-Management (ein Orchestrator), um Ressourcen effektiver zu nutzen, Sichtbarkeit für Angebote zu schaffen und Kooperationen untereinander zu initiieren.
Maßnahme #3: Kontinuierliche Investitionen in die Recheninfrastruktur, um bestehende Wettbewerbsnachteile zu beseitigen.
Maßnahme #4: Die Optimierung der Überführung von Forschungsergebnissen in Innovationen und deren wirtschaftliche Verwertung im bestehenden Ökosystem (Technologietransfer).
Maßnahme #4: Hochschulen und Forschungseinrichtungen stellen eine Stärke des österreichischen KI-Ökosystems dar. Im Hinblick auf ihre wichtige Funktion zur Schaffung von Spin-offs und Startups als Innovationstreiber, muss die Ausbildung von KI-Spezialist*innen weiter ausgebaut werden.
KI-Ökosystem in Österreich
Ein aktuelles Bild des österreichischen KI-Ökosystems zu zeichnen, ist zugegebenermaßen eine Herausforderung. Die Realität entwickelt sich schneller, als sie sich festhalten lässt – sowohl was die künstliche Intelligenz an sich als auch die Unternehmen betrifft, die damit zu tun haben. Eine nationale KI-Strategie wurde jedoch erst 2021 veröffentlicht – womit Österreich als 23. von 27 EU-Mitgliedstaaten vergleichsweise spät dran war.
Laut der Studie der KMU Forschung Austria über KI-Ökosysteme gab es 2024 hierzulande mehr als 300 KI-Unternehmen und Start-ups. Die meisten davon sind im Gesundheitsbereich sowie in der Bild- und Videoverarbeitung tätig.
Doch der wirtschaftliche Einsatz von KI bleibt in Österreich die Ausnahme: Laut Studie setzen mehr als vier Fünftel aller Unternehmen mit zehn und mehr Beschäftigten derzeit keine KI-Technologien ein. Als häufigste Gründe dafür werden fehlendes internes Fachwissen, rechtliche Unklarheiten sowie die Inkompatibilität mit bestehenden Geräten oder Systemen genannt. Darüber hinaus fehlt es den Betrieben an einem niederschwelligen Zugang zu anwendungsrelevantem KI-Wissen.
KI-Guidelines für KMU
Um kleine und mittlere Unternehmen (KMU) dabei zu unterstützen, das Potenzial von KI-Anwendungen zu entdecken und fit für die Nutzung dieser Schlüsseltechnologie zu werden, hat die WKO einen umfassenden Leitfaden entwickelt.
Die zweite, komplett aktualisierte Auflage dieser Guidelines kannst du dir HIER KOSTENLOS HERUNTERLADEN.
Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Datennutzung: Nur 23,9 % der heimischen Unternehmen setzen auf Data Analytics. Das sind deutlich weniger als der EU-Durchschnitt (33,2 %) und die Unternehmen in Vorreiterländern wie den Niederlanden (48,6 %), Deutschland (37,1 %) oder Schweden (35,0 %).
Unterstützung gibt es seit Februar 2024 von der bei der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) eingerichteten KI-Servicestelle. Sie dient als zentrale Anlaufstelle und Informationshub zum Thema künstliche Intelligenz und begleitet Unternehmen bei der Umsetzung des AI Acts.
Doch nicht nur die heimische Wirtschaft zeigt sich zurückhaltend – auch in der breiten Bevölkerung fehlt es bislang an Begeisterung für KI. Die Studie macht dafür vor allem eine mangelnde Aufklärung über die Vor- und Nachteile verantwortlich, die für eine Einschätzung der Risiken und Chancen dieser Technologie entscheidend wäre.
JETZT AUF YOUTUBE: Was kann Zukunft? Innovationen im Fokus
Wenn du neugierig auf die Technologien von Morgen bist, dann bist du beim neuen WKÖ-YouTube-Kanal "Was kann Zukunft?" genau richtig!
Abonniere jetzt den Kanal und erweitere deinen Horizont in Richtung Morgen!
Starke KI-Forschung
Ein Bereich, der in Österreich hingegen besonders gut aufgestellt ist, ist die Forschung. Laut Studie deckt sie ein breites Spektrum an Teilbereichen der künstlichen Intelligenz ab. Dabei punktet Österreich vor allem mit der KI-Grundlagenforschung. Die meisten Forschungsbeiträge werden in den Technologiefeldern Machine Learning, Computer Vision, Natural Language Processing (NLP) and Linguistics sowie Mathematical Optimization veröffentlicht. Mit Forschungsbeiträgen zu Human-Computer Interaction rangiert Österreich unter den Top 20 weltweit.
Schwache Infrastruktur
Was dem KI-Standort Österreich hingegen fehlt, ist eine leistungsfähige Infrastruktur. Zwar steigen die Investitionen in Hard- und Software, doch zentrale Voraussetzungen wie Zugang zu High Performance Computing (HPC) bleiben unzureichend: Laut Studie bewerten 38 % der Befragten den Zugang zu HPC-Systemen hierzulande als (eher) negativ.
Aktuell verfügt Österreich über zwei Supercomputer, die vom Vienna Scientific Cluster (VSC) betrieben werden. Ihre kombinierte Rechenleistung liegt bei rund 5.000 TFlop/s, was lediglich 0,1 % der globalen Gesamtleistung aller KI-Systeme entspricht. Zum Vergleich: Die USA liegen mit 171 Supercomputern und einem Anteil von 53,7 % an der Spitze. Deutschlands KI-Systeme haben mit 40 Supercomputern einen Anteil von 3,3 % an der Gesamtleistung weltweit. Und auch Länder wie die Niederlande, Schweden und Kanada liegen klar vor Österreich.
Die Initiative AI Factory Austria (AI:AT) soll hier Abhilfe schaffen. Sie zielt darauf ab, das österreichische KI-Ökosystem durch den Aufbau einer hochmodernen Recheninfrastruktur mit umfassenden KI-Services nachhaltig zu stärken und damit die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Dazu wird in Wien ein neuer KI-optimierter Supercomputer angeschafft, der Forschung, Startups, Unternehmen und der öffentlichen Verwaltung zur Verfügung steht, um komplexe KI-Modelle zu trainieren und auf verschiedene Anwendungsfelder zu übertragen. Zusätzlich wird ein AI Factory Hub eingerichtet, der als One-Stop-Shop, Coworking-Space und Community-Zentrum dient.
Österreich schwächelt jedoch nicht nur in Bezug auf die technische Infrastruktur. Auch im Bereich des Humankapitals gibt es Aufholbedarf – insbesondere bei Lehrpersonal für KI-relevante Ausbildungen und qualifizierten KI-Fachkräften.
Wie wird KI in Österreich gefördert?
Bei den Förderungs- und Finanzierungsmöglichkeiten für KI-Lösungen überzeugen laut Studie vor allem die Programme der Europäischen Union. Demgegenüber werden nationale Förderinstrumente, die Anschlussfinanzierung für KI-Startups sowie Förderungen durch private Geldgeber:innen als unzureichend bewertet.
Weitere Schwachpunkte betreffen die mangelnde Koordination und Integration bestehender KI-Initiativen und Förderprogramme, die unzureichende öffentliche Grundfinanzierung spezialisierter KI-Forschungseinrichtungen sowie eingeschränkte Fördermöglichkeiten für die KI-Grundlagenforschung auf nationaler Ebene.
Das Wichtigste in Kürze:
- Künstliche Intelligenz hat ein großes Potenzial, Wirtschaftswachstum zu fördern und den Standort zu stärken.
- Um die Chancen zu nutzen, braucht es engagierte Unternehmen, Startups, Universitäten, Verwaltungseinrichtungen, Netzwerke sowie förderliche Rahmenbedingungen.
- Österreich ist in der KI-Forschung stark, hat jedoch Aufholbedarf bei der Infrastruktur, beim Humankapital, der öffentlichen Wahrnehmung von KI, Finanzierungs- und Förderungsmöglichkeiten.