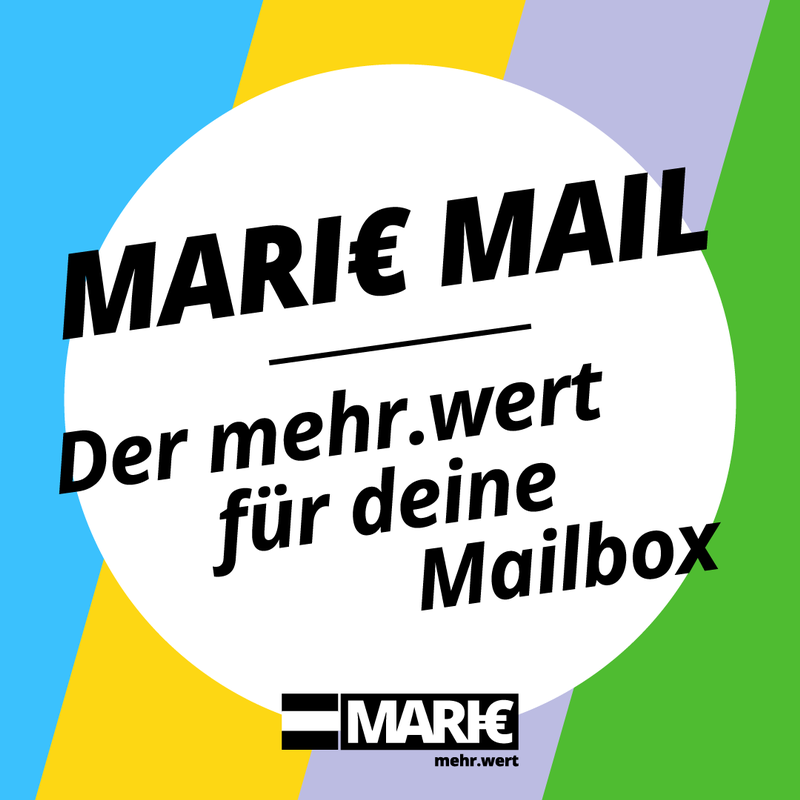Die Weltordnung verändert sich rasant. Welche Auswirkungen hat das auf Europa und Österreich? WKÖ-Ökonomin Claudia Huber gibt Einblicke und zeigt, welche Strategien die EU für die Zukunft braucht.
Die Weltordnung ist in einem tiefgreifenden Wandel. Liberale Grundsätze müssen Rivalitäten weichen; die globalen Machtverhältnisse verschieben sich. Das hat auch gravierende Auswirkungen auf Europa. WKÖ-Ökonomin Claudia Huber erklärt, wie die EU diesen Herausforderungen begegnen kann und welches Ass sie im Ärmel hat.
Die globalen Machtverhältnisse verschieben sich, was passiert da genau?
Claudia Huber: Die Weltordnung ist in einem tiefgreifenden Wandel, und zwar politisch wie wirtschaftlich. Die lange geltende Maxime einer liberalen Weltordnung ist in den Hintergrund gerückt. Dies lässt sich spätestens seit Mitte der 2010er Jahre beobachten. Denken Sie an den Aufstieg neuer Mächte in Asien oder an den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine oder schauen Sie zum Beispiel auf die USA, die für sich eine neue Vormachtstellung beansprucht, wie sich eindrücklich an Donald Trumps Zollpolitik zeigt.
SERVICETIPPS: Info-Point US-Zölle & Exporttag 25
- Mit dem Info-Point "US-Zölle" der WKÖ bleibst du über aktuelle Entwicklungen und Beschlüsse informiert.
- Der Exporttag 25 am 3. Juni 2025 in der Wirtschaftskammer Österreich ist Österreichs bedeutendste Veranstaltung für globale Wirtschaftsstrategien, geopolitische Risiken und transformative Zukunftsmärkte.
Hier geht's zur kostenlosen Anmeldung.
Welche Auswirkungen hat dieses Selbstverständnis der USA?
Huber: Sehr weitreichende, und zwar in politischer genauso wie ökonomischer Hinsicht. Schauen wir uns die Haltung der USA zu China an: Die beiden größten Handelsnationen der Welt betrachten einander zunehmend als Rivalen, protektionistische Maßnahmen gegeneinander werden eingesetzt, und globale Handelsströme verschieben sich. Im Jahr 2016 waren 3 % der weltweiten Importe von protektionistischen Maßnahmen betroffen. 2024 waren es schon 12%.
Spannend ist auch der Blick auf den industriepolitischen Wettlauf zwischen den beiden Weltmächten: Mit dem Inflation Reduction Act fanden die USA eine kraftvolle Antwort auf Chinas industriepolitische Strategie: Hier werden schon lange hohe Summen an staatlichen Interventionen für den Ausbau der industriellen Kapazitäten eingesetzt; und das mit Erfolg, denn in vielen Bereichen konnte China Technologieführerschaft erlangen.
Was bedeutet das für unsere Industrie?
Huber: Für traditionelle europäische Industriestandorte wie Österreich und Deutschland entwickelt sich der industriepolitische Wettkampf dieser zwei Wirtschaftsmächte zu einer existenziellen Herausforderung. Bestes Beispiel in dem Zusammenhang ist die europäische Autoindustrie, die gerade bei der E-Mobilität den Anschluss zu verlieren droht. Der Druck steigt, nicht nur in Schlüsselbranchen wie dieser.
Was heißt das in größerem Kontext für den gesamten Wirtschaftsstandort Österreich?
Huber: Als kleine, offene Volkswirtschaft reagiert Österreich besonders sensibel auf geopolitische Risiken und Spannungen. Der Grund dafür liegt in der starken globalen Verflechtung der österreichischen Volkswirtschaft. Rund 60% des österreichischen Bruttoinlandsprodukts (BIP) stammen aus Exporten von Waren und Dienstleistungen.
Spannende Updates für dich!
Mit der MARI€ MAIL erhältst du unsere wichtigsten Infos direkt in deine Mailbox.
Darüber hinaus verfügt Österreich nur über begrenzte natürliche Ressourcen und ist daher auf Importe von Energie (z. B. Erdgas) und Rohstoffen angewiesen. Diese Abhängigkeit macht stabile internationale Handelsbeziehungen essenziell. Viele österreichische Unternehmen, insbesondere im verarbeitenden Gewerbe, sind tief in globale Lieferketten integriert und importieren Vorprodukte aus dem Ausland.
Außerdem ist der österreichische Binnenmarkt relativ klein. Heimische Unternehmen müssen daher auf ausländische Märkte ausweichen, um zu wachsen und wettbewerbsfähig zu bleiben - und brauchen die entsprechenden Rahmenbedingungen dazu.
Eingebettet ist Österreich aber in der EU und damit im europäischen Binnenmarkt, welche Rolle hat dieser?
Huber: Eine ganz wesentliche. Er ist die Erfolgszutat für Europas Wohlstand und unser Ass im Ärmel, auch und gerade in diesen turbulenten neuen Entwicklungen. Der EU-Binnenmarkt vereint rund 450 Millionen Verbraucher:innen und 31 Millionen Unternehmen. Damit ist er der größte gemeinsame Markt der Welt – das sind unglaublich große Ressourcen, auf die es aufzubauen gilt.
Deswegen muss die Stärkung des EU-Binnenmarktes jetzt oberste Priorität für die EU haben. Mit ihm steht und fällt unsere Wettbewerbsfähigkeit, denn er hat für die EU-Länder eine wichtige Puffer-Funktion gegenüber globalwirtschaftlichen Entwicklungen. Ein starker Binnenmarkt macht resilient, indem er die europäischen Volkswirtschaften enger miteinander verbindet, Abhängigkeiten reduziert und eigene Wertschöpfungsketten in der EU festigt.
Wo hat die EU jetzt noch Handlungsbedarf, um nicht ins Hintertreffen zu geraten?
Huber: Die EU muss sich auch politisch bewegen und weiterentwickeln, um auf globaler Ebene souveräner agieren zu können. Eine stärkere Zusammenarbeit etwa in den Bereichen Verteidigung und Energieversorgungssicherheit ist notwendig, um nicht weiter zum Spielball geopolitischer Interessen zu werden.
Denn eines steht fest: In einer Weltordnung, in der Machtpolitik zunehmend die internationalen Beziehungen bestimmt, sind nationalstaatliche Eigeninteressen und politische Uneinigkeit in Europa nicht nur wirtschaftlich schädlich, sondern auch in sicherheitspolitischer Hinsicht fatal.
Das Wichtigste in Kürze:
- Die Weltordnung wandelt sich, Machtpolitik rückt in den Fokus.
- Die USA und China liefern sich ein industriepolitisches Wettrennen.
- Österreich als kleine Volkswirtschaft ist besonders betroffen.
- Der EU-Binnenmarkt ist essenziell für Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit.
- Politische Einigkeit ist entscheidend, um Europas Rolle zu stärken.