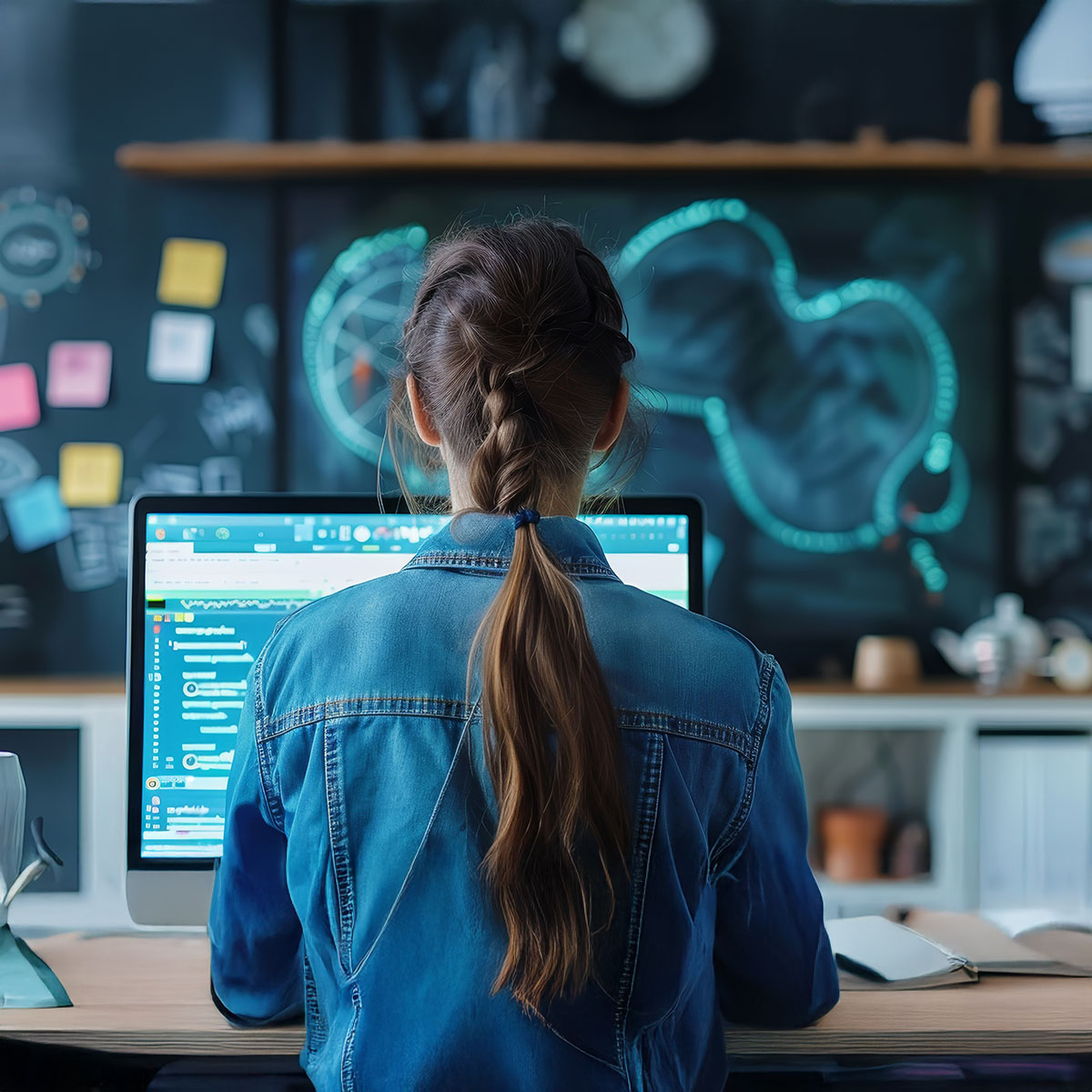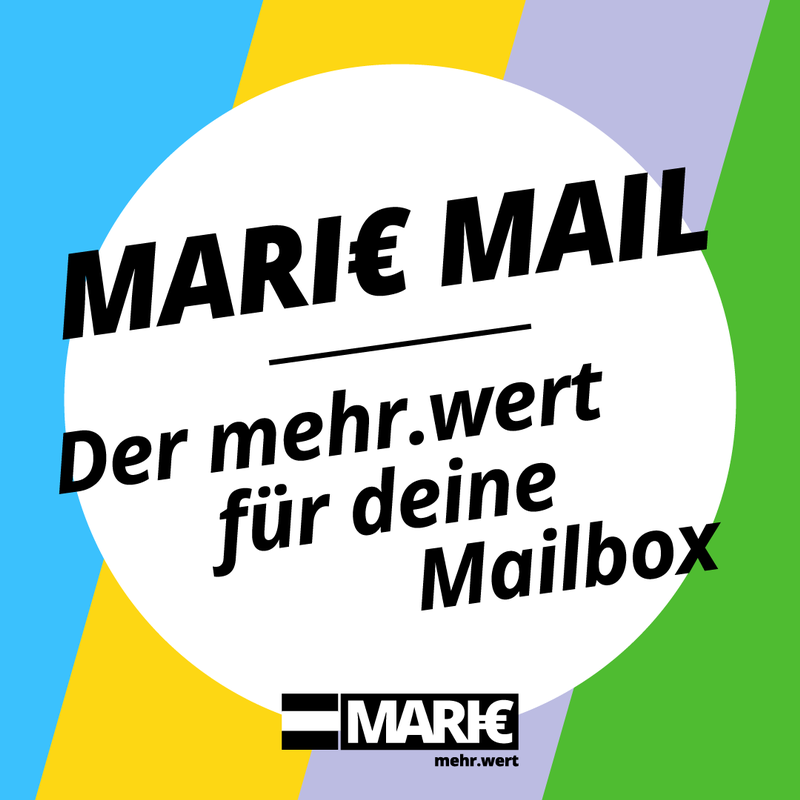Digitale Bildung ist heute nicht Kür, sondern Pflicht – für Wirtschaftswachstum, Innovationskraft und Zukunftschancen junger Menschen. Doch wie digital-fit ist Österreichs Schulsystem 2025 wirklich? Zwischen Pilotprojekten, Pflichtfach und Förderprogrammen zeigt sich ein differenziertes Bild.
Digitale Bildung ist heute kein Zusatz mehr, sondern eine zentrale Voraussetzung für die Zukunftschancen junger Menschen, für wirtschaftliche Entwicklung und für Innovationskraft. Doch wie gut ist Österreich im Jahr 2025 tatsächlich aufgestellt? Zwischen Pflichtfach, Pilotprojekten und Förderprogrammen zeigt sich ein gemischtes Bild.
Tablet statt Tafel, ChatGPT statt Duden, Fake News erkennen statt Wikipedia abschreiben: Der Alltag in Österreichs Klassenzimmern verändert sich. Seit dem Schuljahr 2022/23 ist das Pflichtfach Digitale Grundbildung in der Sekundarstufe I, also von der 5. bis 8. Schulstufe, fix im Lehrplan verankert. Schülerinnen und Schüler lernen hier, wie Algorithmen funktionieren, wie man sichere Passwörter erstellt, wie man verlässliche Informationsquellen erkennt und welche Potenziale und Risiken Künstliche Intelligenz mit sich bringt.
Pflichtfach mit Anlaufschwierigkeiten
Die Einführung der Digitalen Grundbildung war ein Meilenstein. Bei der Umsetzung zeigten sich allerdings einige Hürden. Eine erste Befragung unter Lehrenden 2023 offenbarte große Unsicherheiten: Mehr als 55% der Befragten bewerteten ihre eigenen Kenntnisse im unterrichteten Fachbereich als "befriedigend" oder schlechter – insbesondere bei Themen wie Programmierung oder Algorithmen.
Spannende Updates für dich
Mit der MARI€ MAIL erhältst du unsere wichtigsten Infos direkt in deine Mailbox.
Jetzt zum Newsletter anmelden!Lehrer:innen auf Digital-Kurs
Die gute Nachricht: Mittlerweile gibt es spürbare Fortschritte. In mehreren Bundesländern, etwa in Kärnten, Tirol und der Steiermark, haben Lehrkräfte gezielte Aus- und Weiterbildungen absolviert. Zusätzlich gibt es seit 2021 einen viersemestrigen Hochschullehrgang ‚Digitale Grundbildung‘ (30 ECTS), der von den Pädagogischen Hochschulen angeboten wird. Auch das Bachelorstudium Digitale Grundbildung und Informatik an der Universität Wien, das seit zwei Jahren läuft, wird künftig neue Fachkräfte hervorbringen. Die ersten Absolvent:innen werden ab 2027 erwartet. Diese Entwicklungen stärken die langfristige Qualität des Unterrichts. Dennoch bleibt der Weiterbildungsbedarf hoch, insbesondere im Hinblick auf Didaktik und digitale Tools.
Digitale Kompetenzen im Vergleich
Wie gut sind Österreichs Schülerinnen und Schüler tatsächlich auf die digitale Welt vorbereitet? Die internationale ICILS-Studie (International Computer and Information Literacy Study) misst regelmäßig, wie kompetent Jugendliche mit digitalen Technologien umgehen – etwa beim Recherchieren, Bewerten und Weiterverarbeiten von Informationen im Internet. Österreich nimmt seit 2018 an der Studie teil. Bei der letzten Erhebung im Jahr 2023 erzielten die heimischen Schüler:innen im Durchschnitt 506 Punkte. Damit liegen sie über dem internationalen Mittelwert von 476 Punkten und auch über dem EU-Durchschnitt von 493 Punkten, aber noch deutlich hinter den Spitzenreitern.
 i
iSo digital kann Lehre heute schon sein
 i
i Wie Digitalisierung die Weiterbildung revolutioniert
Besonders erfolgreich sind Länder wie Südkorea, Finnland und Estland. Dort wird seit Jahren gezielt in digitale Bildung investiert – mit Fokus auf Infrastruktur, Lehrkräftequalifizierung und der systematischen Verankerung im Lehrplan. Österreich liegt derzeit im Mittelfeld und hat deutliches Aufholpotenzial.
Zwischen Leuchtturmprojekten und Lücken
Herausforderungen bestehen insbesondere bei der technischen Ausstattung, beim digitalen Know-how der Lehrkräfte und in der Chancengleichheit zwischen verschiedenen Schultypen und Regionen.
Sie betont, dass es aber nicht nur um die technische Ausstattung im Klassenzimmer gehe, sondern auch um pädagogische Konzepte und gezielte Unterstützung für Lehrkräfte. "Digitalisierung muss didaktisch mitgedacht werden – nicht jede neue Technologie verbessert automatisch den Unterricht", so Schneider-Lugger.
Tatsächlich zeichnet sich in Österreich ein sehr unterschiedliches Bild: Während einige Schulen bereits mit innovativen KI-Projekten arbeiten, fehlt anderenorts noch immer ein stabiles WLAN. Die digitale Realität reicht von Vorzeigeschulen bis zu Einrichtungen mit deutlichem Entwicklungsbedarf.
Auf dem richtigen Weg
In den vergangenen Jahren wurden zentrale Weichen gestellt: Digitale Grundbildung ist inzwischen fester Bestandteil des Lehrplans. Der 8-Punkte-Plan des Bildungsministeriums gibt Orientierung und eine strukturierte Richtung vor. Plattformen wie LMS.at, Eduvidual oder Digi4School unterstützen den digitalen Unterricht. In den vergangenen Jahren wurden an einzelnen Schulen KI-Anwendungen pilotiert, diese Projekte sind inzwischen abgeschlossen. Programme wie EdTech Austria fördern die Zusammenarbeit von Start-ups und Bildungseinrichtungen. Initiativen wie eEducation Austria bringen Innovationen direkt in den Unterricht. Ein neues Gütesiegel für Lern-Apps sichert die Qualität in den Schulen.
Österreich bewegt sich also in die richtige Richtung, doch der Weg ist noch lang. Entscheidend ist nun eine abgestimmte, langfristige Gesamtstrategie. Einzelne Pilotprojekte reichen nicht aus. Wirkungsvolle Digitalisierung braucht eine flächendeckende Umsetzung, gezielte Investitionen in Infrastruktur sowie die kontinuierliche Qualifizierung der Lehrkräfte. Dabei gibt es bereits zahlreiche Best-Practice-Beispiele – etwa das Projekt ‚Embracing Technology‘ der Innovationsstiftung für Bildung. Auch die Selbstlernkompetenz von Schüler:innen und Lehrlingen muss gezielt gestärkt werden. Digitale Plattformen wie wîse up, die Aus- und Weiterbildungsplattform der Wirtschaftskammern Österreichs, bieten dafür bereits konkrete Unterstützung.
wîse up: Service für Österreichs Unternehmen
Diese Inhalte allein reichen jedoch nicht – sie müssen im betrieblichen Alltag auch gezielt eingesetzt werden. Genau hier setzt wîse up, die digitale Bildungsplattform der WKO, an: Die Plattform unterstützt Unternehmen dabei, Weiterbildungsprozesse effizient zu organisieren.
wîse up bietet seinen Nutzer:innen 25.000 Online-Kurse, die jederzeit und ortsunabhängig verfügbar sind. Diese beinhalten wichtige Themen wie neues Wissen zu Marketing, KI, Technologien und auch zahlreiche Lerninhalte für die Persönlichkeitsentwicklung. Unternehmen können Lerninhalte gezielt zuweisen, den Fortschritt ihrer Mitarbeitenden begleiten und mit interaktiven Formaten wie Videos und Quizzes sicherstellen, dass Wissen nicht nur konsumiert, sondern nachhaltig verankert wird.
Ergänzend dazu finden sich auf wîse up Module zu Themen wie Unternehmensführung, Finanzplanung oder Projektmanagement – also genau jene Skills, die in Zeiten der Digitalisierung besonders gefragt sind.
"Die Fähigkeit, sich eigenständig Wissen anzueignen, ist in einer digitalisierten Welt entscheidend. Nicht nur für die Arbeitswelt, sondern auch für das Lernen selbst. Deshalb setzen auch immer mehr Berufsschulen und Ausbildungsbetriebe in Österreich auf wîse up als digitale Ergänzung zur klassischen Lehre", sagt Sigrid Hantusch-Taferner, Geschäftsführerin von wîse up. Gerade die Verbindung von strukturierten Lernangeboten und digitalen Tools könne dabei eine zentrale Rolle spielen.
Das Wichtigste in Kürze:
- Pflichtfach Digitale Grundbildung ist ein Meilenstein, die Umsetzung aber teils noch holprig.
- Lehrkräfte werden weitergebildet, es gibt erste Absolvent:innen.
- Schüler:innen liegen international im Mittelfeld, mit großen Unterschieden zwischen Schulen.
- Zahlreiche Maßnahmen und Programme wie KI-Pilotschulen, EdTech Austria oder eEducation bringen Dynamik.
- Zukunft braucht Strategie: Langfristige Planung, Infrastruktur und Lehrerfortbildung sind jetzt entscheidend.