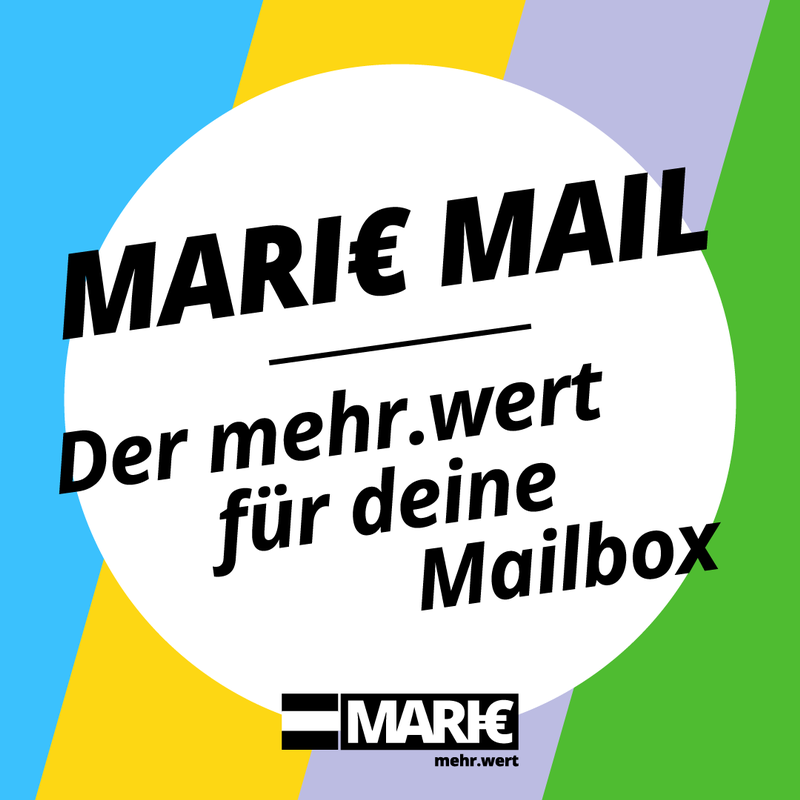Kleine Pakete, große Wirkung: Die 150-Euro-Zollfreigrenze kostet Europa hunderte Millionen – und verzerrt den Wettbewerb zulasten heimischer Betriebe.
Der Online-Handel boomt – und mit ihm die Zahl der Päckchen aus Fernost. Plattformen wie Temu, Shein oder AliExpress liefern günstig, schnell und meist zollfrei. Der Grund dafür ist eine scheinbar harmlose Grenze: Für Sendungen unter 150 Euro fällt in der EU kein Zoll an.
Was als Erleichterung für Konsument:innen gedacht war, ist heute ein ernsthaftes Problem für den Binnenmarkt, für heimische Händler:innen und für die öffentlichen Haushalte.
750 Millionen Euro Schaden – jedes Jahr
Laut EU-Kommission werden bis zu 65% der Pakete aus Drittstaaten zu niedrig deklariert – bewusst, um unter die Zollfreigrenze zu fallen. Hochwertige Produkte werden in mehrere Teilsendungen aufgesplittet. Das Ergebnis: Keine Zölle. Zudem werden die Pakete nicht in Österreich zollrechtlich abgefertigt, sondern wird dieser Prozess in Ungarn und in Belgien durchgeführt. Der österreichische Zoll hat keine Kontrollmöglichkeit.
Die Folge:
- Der EU entgehen jährlich rund 750 Millionen Euro an Zolleinnahmen.
- Heimische Unternehmen stehen in direkter Konkurrenz zu Anbieter:innen, die sich kaum an Regeln halten.
- Durch den systematischen Missbrauch der Paketstückelung zur Umgehung der Zollpflicht entsteht der Umwelt erheblicher Schaden durch erhöhten Verpackungs- und Transportaufwand.
"Was wie ein Schnäppchen wirkt, ist in Wahrheit eine systematische Wettbewerbsverzerrung", bringt es Iris Thalbauer, Geschäftsführerin der Bundessparte Handel in der WKÖ, auf den Punkt.
Spannende Updates für dich!
Mit der MARI€ MAIL erhältst du unsere wichtigsten Infos direkt in deine Mailbox.
Plattformen nutzen Regelungslücken – und Konsument:innen ahnen nichts
Denn nur die wenigsten Käufer:innen wissen, wie ihre Bestellung verzollt wird. Viele Plattformen umgehen nationale Kontrollsysteme, indem sie ihre Pakete etwa über Ungarn oder Belgien einführen, wo die Zollabfertigung erfolgt. Zwar sieht der EU-Zollkodex eine Harmonisierung der Zollverfahren in allen Mitgliedstaaten vor, dennoch liegt die Vermutung nahe, dass in Ländern mit besonders hohem Paketaufkommen – wie Ungarn oder Belgien – die Kontrollsysteme überlastet sind und Missbräuche nicht ausreichend erkannt werden. Folge: In Österreich kommt die Ware nur noch an – kontrolliert wird hier nichts mehr.
Problematisch ist auch, dass die Plattformen zwar als Vermittler auftreten, aber nicht die volle Verantwortung für den Import übernehmen – die Einhaltung von Produktsicherheitsvorschriften und die Sicherstellung der Abgabe von Lizenzen (z.B. Verpackung, Elektroaltgeräte) sind im EU-Raum durch Bevollmächtigte durchzuführen, die schwer bis gar nicht greifbar sind. Die Umsatzsteuer bei einem Warenwert von über 150 Euro wird nicht von den Plattformen geschuldet und die Kontrollen für die heimischen Behörden sind extrem schwierig, da der Händler in China nicht greifbar ist.
GRAFIK: Entwicklung der Handelsbilanz zwischen Österreich und China
Die Lösung liegt am Tisch – aber dauert (zu) lange
Die EU-Zollreform, vorgestellt im Mai 2023, will das Problem angehen. Geplant ist dabei unter anderem:
- die Abschaffung der 150-Euro-Zollfreigrenze (ab 2028),
- Plattformen sollen verpflichtet werden, unabhängig vom Warenwert für Zölle und Steuern zu haften und sicherstellen, dass die Einkäufe den EU-Umwelt-, Sicherheits- und Ethikstandards entsprechen.
- Die Einrichtung einer EU-Zollbehörde sowie einer zentralen EU-Zolldatenbank (EU Customs Data Hub) zur besseren Kontrolle.
Die Interessenvertretung des heimischen Handels fordert daher, Plattformen zu zentralen Akteuren zu machen – so wie es in der Zollreform skizziert ist. Sie sollen stärker in die Verantwortung genommen werden, indem sie unabhängig vom Warenwert für Zölle und Steuern haften und sicherstellen, dass die Einkäufe den EU-Umwelt-, Sicherheits- und Ethikstandards entsprechen.
Ein zentraler Punkt ist die vorzeitige Streichung der Zollfreigrenze – spätestens bis 2026 und nicht erst wie aktuell vorgesehen im Jahr 2028. Ebenso notwendig ist die Einführung einheitlicher Standards bei der Zollkontrolle, nur so lassen sich systematische Missbräuche wie Unterdeklarationen wirksam bekämpfen. Dafür braucht es dringend eine EU-Zollbehörde sowie eine zentrale Zolldatenbank (EU Customs Data Hub), die eine effektive länderübergreifende Risikoanalyse und -prüfung ermöglicht.
Die Einführung einer Bearbeitungsgebühr als Übergangslösung wird als nicht ausreichend wirksam angesehen – insbesondere, wenn deren Anwendung nicht in allen Mitgliedstaaten verpflichtend vorgeschrieben wird.
 i
iDie 150-Euro-Grenze war einst eine bürokratische Erleichterung. Heute ist sie ein Bremsklotz für fairen Wettbewerb und Abgabengerechtigkeit.
Fairer Wettbewerb geht anders
Denn für österreichische Unternehmen ist die aktuelle Lage ein struktureller Nachteil: Während diese Abgaben zahlen, Umweltstandards beachten und alles korrekt dokumentieren, finden diese Auflagen bei Temu, Shein, AliExpress & Co nur wenig Beachtung. Viele europäische Regelungen wie das anstehende Lieferkettengesetz oder die Entwaldungsverordnung gelten für chinesische Plattformen nicht.
Nicht zuletzt deswegen wächst auch auf europäischer Ebene der Druck: Der europäische Verband EuroCommerce, bei dem auch die WKÖ Mitglied ist, fordert eine schnelle Umsetzung der Reformpläne. Denn je länger die Schieflage besteht, desto schwieriger wird es, Vertrauen und Fairness im digitalen Handel wiederherzustellen.
Jetzt handeln, nicht erst 2028
"Ein funktionierender Binnenmarkt braucht klare Regeln – für alle. Die 150-Euro-Grenze war einst eine bürokratische Erleichterung", sagt Iris Thalbauer. "Heute ist sie ein Bremsklotz für fairen Wettbewerb und Abgabengerechtigkeit. Jetzt ist der Moment, um zu handeln. Nicht 2028. Sondern jetzt."
Das Wichtigste in Kürze:
- Pakete unter 150 € aus Drittstaaten wie China sind derzeit zollfrei – viele Anbieter nutzen das gezielt aus.
- Laut EU-Kommission entgehen der EU dadurch jährlich rund 750 Millionen Euro an Zolleinnahmen.
- Die WKÖ fordert, die Zollfreigrenze sofort abzuschaffen – nicht erst wie geplant ab 2028.
- Plattformen wie Temu oder Shein sollen als Zoll- und Steuerpflichtige direkt zur Verantwortung gezogen werden.
- Derzeit profitieren diese Anbieter von gesetzlichen Lücken, während heimische Händler:innen volle Abgabenlasten tragen.